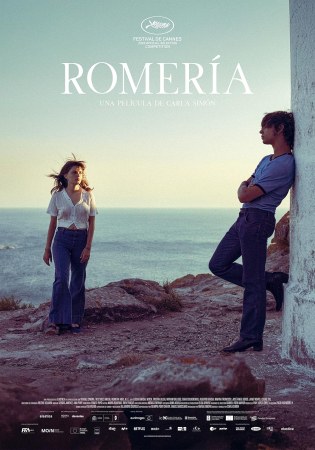Die 17-jährige
Marina betrachtet die Welt durch ihre kleine Digicam. Mit ihr reist sie nach
Vigo, die galicische Hafenstadt, in der einst ihre Eltern lebten. Eigentlich
braucht sie nur ein Dokument für ein Stipendium, doch der Aufenthalt wird zur
Spurensuche nach ihrer Herkunft. Die Begegnungen mit Verwandten bleiben kühl,
niemand will über die Vergangenheit sprechen. Allmählich begreift Marina, dass
es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern nur verschiedene Formen des Erinnerns.
Regisseurin
Carla Simón, die mit „Summer 1993" und ihrem Berlinale-Gewinner
„Alcarràs" das europäische Familienkino neu geprägt hat,
geht mit „Romería" einen Schritt weiter. Das spürbar biographische
Werk, das im Wettbewerb von Cannes lief, verhandelt zwar wieder das Prinzip der
Familie, dieses fragile Geflecht aus Nähe, Schweigen und Verdrängung – diesmal
jedoch ist es verankert als präzises Zeitporträt Galiciens in den
1990er-Jahren. Es ist die Zeit von Drogen und alternativen Lebensstilen, die
dem Ende der Franco-Diktatur folgte. Simón
baut daraus ein poetisches Erinnerungsstück. Archivbilder verweben sich mit
Spielszenen, Zeiten überlagern sich, Vergangenes kehrt fast körperlich
zurück. „Romería" wird so zur Familienchronik und zum kollektiven
Gedächtnis zugleich: ein intimes, zärtliches Patchwork und eine Arbeit am
kollektiven Gedächtnis Spaniens, das auch den Opfern der AIDS-Epidemie gewidmet
ist, deren Spuren in vielen Familiengeschichten lange verschwiegen wurden.